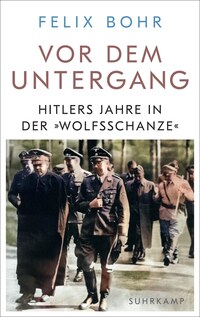Zum Buch:
Die Wolfsschanze: gewöhnlich findet dieses Wort in Zusammenhang mit Stauffenbergs Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 Erwähnung. Kaum bekannt dagegen ist, dass die an der Ostgrenze des Deutsches Reichs gelegene Wolfsschanze das militärische Hauptquartier des „Führers“ war, von dem die Vernichtung der Juden Europas befohlen wurde und Hitler seinen verbrecherischen Krieg vorantrieb. Mit seinem neuen, sehr lesenswerten Buch gelingt es Felix Bohr, Historiker und Journalist, diese NS-Machtzentrale aus der Peripherie stärker ins Zentrum der Erinnerung zu holen. Mit wissenschaftlicher Akribie und gestützt auch auf Tagebücher und Memoiren schildert er anschaulich und detailreich Hitlers Jahre und den Alltag des Lebens in der Wolfsschanze. Sie umfasste ein etwa 800 Hektar großes, in drei Sperrkreise unterteiltes, hermetisch abgeschlossenes Areal inmitten eines dichten, sumpfigen Waldes in der Nähe von Rastenburg, dem heutigen Ketryzin. Die bis zu 2000 Soldaten, SS-Leute und Zivilisten wohnten in simplen Holzbaracken und hinter meterdicken Bunkerwänden, eine gut getarnte Stadt mit Friseursalon, Kino und Brauerei. Zeitzeugen empfanden die Atmosphäre gleichwohl als drückend, ja klaustrophobisch. Ab 1941, mit Beginn des Angriffkriegs auf die Sowjetunion, bezog der „größte Feldherr aller Zeiten“ in der Wolfsschanze Quartier, er wollte nah an der Front sein. Hitler lebte im innersten Sperrkreis in einem hochgesicherten Bunker, umgeben von den um die Gunst des „Führers“ buhlenden NS-Größen und Wehrmachts-Generälen. Die sich letztlich stets dem Wort des Diktators beugten, selbst als er zunehmend gesundheitlich verfiel, ein Verfall, den der Autor en detail schildert. Hitler, die längst absehbare militärische Niederlage wahnhaft verleugnend, gab abgeschottet in seinem Bunker weiterhin Befehle, die noch Millionen Menschen das Leben kosteten. Hitler war ein Wrack, als er 2. November 1944 angesichts der nahenden Roten Armee die Wolfsschanze in seinem abgedunkelten Luxuszug verließ und dem endgültigen Untergang entgegen fuhr.
Michaela Wunderle, Frankfurt