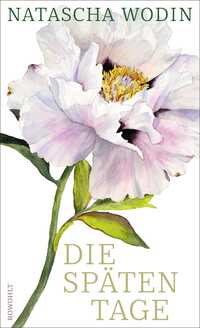Zum Buch:
Zwei Menschen über siebzig: die Schriftstellerin Natscha Wodin, Kind russischer Zwangsarbeiter, die nach dem Krieg in Deutschland blieben, und der sieben Jahre ältere, in der DDR aufgewachsene Friedrich, der nach seiner Flucht in die BRD zum damals jüngsten Mathematikprofessor des Landes wurde. Beide leben alleine und haben sich darin eingerichtet. Sie sind nicht unzufrieden, aber auch nicht glücklich. Als sie aufeinandertreffen, ist es Liebe. Anfangs überwiegen Erstaunen über die Intensität der Gefühle, Romantik und Leidenschaft, dann aber, wie in den meisten Beziehungen, kommt es auch zu heftigen Auseinandersetzungen und Zerwürfnissen. Aber ihre Liebe bleibt. Immer häufiger schiebt sich das Alter, drängen sich beider Krankheiten in den Vordergrund. Wodin ist kaum noch im Stande zu laufen und Friedrich hat nur noch eine Herzleistung von dreißig Prozent. In Wodin kommt der Wunsch auf, das unweigerlich kommende Ende nur mit sich selbst auszumachen. Aber da ist auch die Angst vor dem erneuten Alleinsein und vor allem die Erkenntnis, den anderen nicht im Stich lassen zu können. Denn ihre Liebe bleibt.
Wodin beschreibt ihren Alltag zwischen ihrem Haus am See in Brandenburg und Friedrichs von seiner reichen Frau geerbtem und mit Antiquitäten vollgestopftem Haus in Lübeck. Der Text ist durchmischt mit den Erinnerungen der Autorin an ihre Herkunft und ihr Leben, ihr Aufwachsen in der „Russensiedlung“ am Rande der Stadt, den Selbstmord ihrer Mutter, ihre schwierigen Beziehungen zu Männern und ihren nur aus eigener Kraft erreichten Weg als Dolmetscherin, Übersetzerin und Schriftstellerin – aber auch mit Reflektionen über Liebe, Glück, Enttäuschung und Angst, Freundschaft, Krankheit und Sterben.
Das Buch beschreibt keinen sanft-melancholischen Nachsommer eines alten Paares. Die späten Tage erzählt zwar vom Erstaunen und der Freude über das unwahrscheinliche Geschenk der späten Liebe, aber auch von der Angst, wie es weitergehen wird mit den immer schwächer werdenden Körpern, den zunehmenden Schmerzen und dem Gefühl, durchhalten zu müssen, weil man den anderen nicht im Stich lassen kann. Wodin beschönigt nichts, weicht nicht aus – und manches ist beim Lesen schwer auszuhalten. Trotzdem ist die Lektüre nicht niederschmetternd, denn das Spektrum der Themen reicht von den existentiellen Fragen von Leben und Sterben bis zu kafkaesken Szenen des deutschen Alltags, etwa den Versuch der Autorin, ihren Pass verlängern zu lassen, was an der in Sütterlinschrift verfassten Geburtsurkunde und den unterschiedlichen Schreibweisen ihres Namens grotesk scheitert. Erzählt in kurzen, prägnanten Sätzen, die nichts beschönigen und oft die Grenze des Sagbaren streifen, dabei niemals larmoyant, aber häufig ironisch und hinreißend komisch sind, fesselt die Lektüre von der ersten bis zur letzten Seite.
Ruth Roebke, Frankfurt